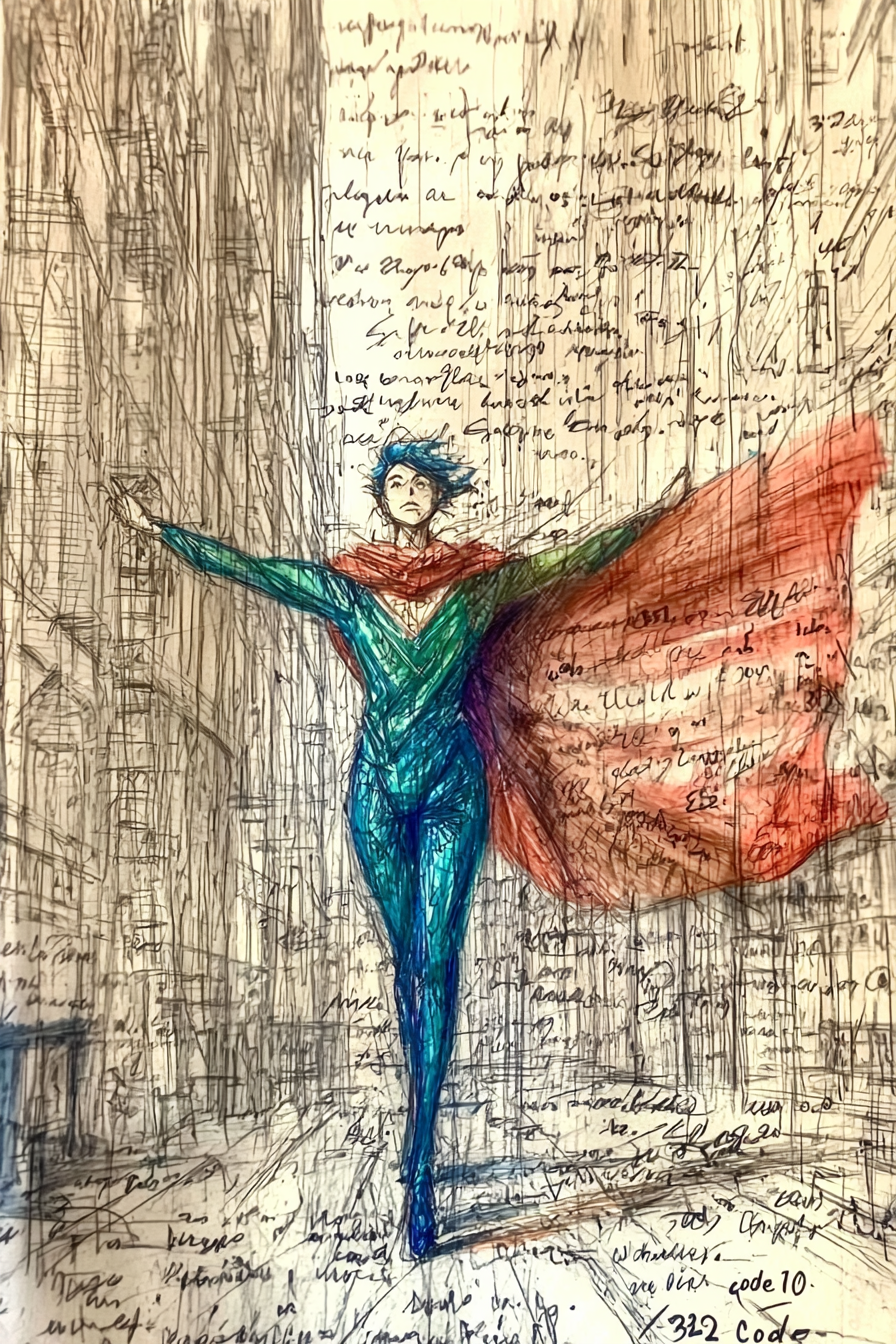Was im Gehirn passiert, wenn wir Kunst erleben und Kreativitätserfahrung mit Suchterkrankungen und ihrer Behandlung und Erholung
Der aktuelle Artikel „What happens in the brain when we experience art“ aus dem Monitor on Psychology der APA (September 2025) beschreibt, was im Gehirn passiert, wenn wir Kunst erleben — also visuell wahrnehmen, innerlich darauf reagieren, interpretieren, emotional involviert werden usw. Er zieht Erkenntnisse aus der Neuroästhetik und psychologischen/neurobiologischen Studien heran, um Verbindungen herzustellen zwischen ästhetischer Erfahrung und neugierigen Gehirnprozessen.
Wichtige Befunde & Konzepte
Hier sind die zentralen Einsichten und Erkenntnisse:
Default Mode Network (DMN) & introspektive Prozesse
Wenn Menschen auf Kunst stoßen, die sie als bedeutsam empfinden, wird das Netzwerk aktiviert, das mit Selbstreflexion und inneren Gedanken verknüpft ist (das sogenannte Default Mode Network). APA
Mit anderen Worten: Kunst kann uns dazu bringen, in uns hineinzugehen, Gedanken und Gefühle zu reflektieren.
Unterschiede zwischen gegenständlicher und abstrakter Kunst
Bei realistischer, gegenständlicher Kunst zeigen Gehirnantworten unter Menschen deutliche Ähnlichkeit — vermutlich, weil solche Kunst leichter zu interpretieren und universeller verständlich ist. Medsearch Limited
Bei abstrakter Kunst sind die Reaktionsmuster heterogener — jeder reagiert mehr „auf seine eigene Art“. Medsearch Limited
Verbindung von Wahrnehmung, Emotion und Bedeutung
Kunst stimuliert nicht nur die visuellen Zentren, sondern integriert auch emotionale und kognitive Regionen: das Gehirn versucht, Wahrnehmung, Erinnerung, Bedeutungsgebung und emotionale Resonanz zusammenzuführen. APA
Diese Integration ist ein Kern dessen, was Kunsterlebnis besonders macht.
Bedeutung für persönliches Wachstum & gesellschaftlichen Wandel
Der Artikel verweist auch auf die Rolle von Kunst über das Einzelne hinaus: Wie Kunstprozesse Identität, Empathie oder soziale Auseinandersetzung fördern können. APA
Kunst kann also nicht nur „ästhetisches Vergnügen“ sein, sondern auch zur psychischen Gesundheit oder gesellschaftlichem Engagement beitragen.
Forschungslücken & Zukunftsperspektiven
Obwohl viele interessante Befunde existieren, ist die Datenlage oft noch begrenzt (z. B. kleine Stichproben, wenige experimentelle Studien) APA
Der Artikel ruft dazu auf, mehr interdisziplinäre Forschung zu betreiben, um zu verstehen, wie genau Kunst im Gehirn wirkt und wie man dieses Wissen praktisch nutzen kann, etwa in Therapie, Bildung oder Kunstvermittlung. APA
Theoretische Überlegungen: Wie Kunst / ästhetische Erfahrung mit Suchtrelevanten Hirnprozessen interagieren könnte
Um anzudenken, wie die im Artikel beschriebenen Mechanismen (z. B. Aktivierung von Netzwerken für Bedeutung, Emotion, Selbstreflexion) mit Sucht und Genesung zusammenhängen könnten, hier einige plausible Brücken:
-
Belohnungssystem & Dopamin
-
Sucht wirkt häufig über eine Dysregulation des dopaminergen Belohnungssystems: Substanzen überschütten das Gehirn mit Dopamin, überstimulieren das System, und durch Anpassungsreaktionen (“Downregulation”) werden normale Reize weniger befriedigend.
-
Kunst und ästhetische Erfahrungen könnten – zumindest in bestimmten Fällen – eine (milde) Aktivierung des Belohnungssystems auslösen (z. B. durch Freude, “Flow”, Überraschung, Sinnstiftung). Diese Aktivierung könnte helfen, das Belohnungssystem auf gesunde Erfahrungen zurückzulenken, zumindest als eine unterstützende Komponente.
-
-
Neuroplastizität
-
Genesung von Sucht erfordert oft, dass neuronale Bahnen umgebaut oder neu ausgerichtet werden: neue Verknüpfungen z. B. zwischen Kontrollmechanismen, alternativen Belohnungen, Emotionsregulation etc.
-
Kunst- und kreative Prozesse fordern das Gehirn – visuell, emotional, kognitiv – heraus und könnten solche plastischen Prozesse stimulieren (z. B. neue Assoziationen, neue Verknüpfungen) und so zur Reorganisation beitragen.
-
-
Trauma, Emotionsverarbeitung & Nicht-verbaler Ausdruck
-
Viele Menschen mit Substanzgebrauchsstörungen haben neben der Sucht auch Traumata, emotionale Dysregulation, Schwierigkeiten beim Ausdruck und der Verarbeitung innerer Zustände.
-
Kunsttherapie bietet einen nicht-verbalen Zugang, um Gefühle, Erinnerungen und innere Konflikte auszudrücken, die mit Worten schwer zugänglich sind.
-
Dieser Zugang kann helfen, neuronale Netzwerke zu aktivieren, die mit interozeptiver Bewusstheit, Emotionsregulation und Integration von Gedächtnisinhalten verknüpft sind.
-
-
Narrative Identität & Sinnstiftung
-
Ein Teil des Genesungsprozesses besteht darin, eine (neue) Lebensgeschichte zu gestalten, Identität neu zu formieren (nicht mehr als „Süchtiger“, sondern als Person mit Sinn, Werten etc.).
-
Ästhetische Erfahrungen bzw. kreative Prozesse können helfen, Narrative zu visualisieren und zu externalisieren, was wiederum hilft, neuronale Netzwerke für Selbstbezug, Erinnerung und Zukunftsprojektion zu integrieren (z. B. das Default Mode Network, das mit Selbstreflexion assoziiert ist).
-
-
Soziale Resonanz & Synchronisation
-
In Gruppensettings (z. B. gemeinsame Kunstprojekte, Ausstellungen, Kunsttherapie-Gruppen) kann Kunst als Brücke dienen, um soziale Bindung, Spiegelung, empathische Resonanz zu fördern.
-
Solche Interaktionen können neuronale Synchronisation (z. B. im Rahmen von Spiegelneuronen oder neurophysiologischer Kopplung) fördern, was wiederum das Zugehörigkeitsgefühl und die Gemeinschaft stärkt – ein wichtiger Schutzfaktor gegen Rückfall.
-
-
Stressmodulation & Regulation
-
Sucht ist oft mit Stress, Dysregulation des limbischen Systems und Übererregung verbunden.
-
Kunst bzw. ästhetische Wahrnehmung kann bei manchen Personen beruhigend wirken, Stresshormone senken und die Regulation von Emotionen unterstützen – wenn das Erlebnis nicht überfordernd ist.
-
Damit könnte Kunst helfen, die Stressreaktivität zu senken, die in vielen Rückfallszenarien eine Rolle spielt.
-
Empirischer Stand & Studienlage
Obwohl die theoretischen Überlegungen plausibel sind, ist die empirische Evidenz bisher begrenzt. Hier sind einige wichtige Studien und Übersichtsarbeiten, die Zusammenhänge zwischen Kunsttherapie / ästhetischer Aktivität und Sucht / Genesung untersucht haben:
| Studie / Artikel | Wesentliche Befunde / Aussagen | Limitationen / offene Fragen |
|---|---|---|
| Quinn, “Art therapy’s engagement of brain networks for enduring …” (2025) | Der Artikel schlägt vor, dass Kunsttherapie bei Substanzgebrauchsstörung (SUD) aktiviert, was auch bei traumatischen Prozessen verändert ist, z. B. Netzwerke der Belohnung, sowie Verfahren, die bei kognitiven Defiziten hilfreich sind. (PMC) | Vorwiegend Vorschläge und Fallbeispiele; es fehlen große randomisierte Studien, um Kausalität und Effektgrößen zu belegen |
| Strang et al., “Art therapy and neuroscience: evidence, limits, and myths” (2024) | Gute Übersicht über das Potenzial von Kunsttherapie aus neurobiologischer Sicht. Betont, dass viele Mechanismen (Neuroplastizität, Spiegelung, Wahrnehmung ↔ Gefühl) plausibel sind, aber dass empirische Daten oft korrelativ sind. (Frontiers) | Schwierigkeit, konkrete neuronale Mechanismen isoliert nachzuweisen; viele Studien sind klein, heterogen |
| Hutson & Hutson, “Toward a Unified Neuroaesthetic Framework for Art-Based Interventions in Substance Use Recovery” | Versucht, ein integriertes Rahmenmodell zu entwickeln mit drei Schlüsselprozessen: sensorische Regulation, narrative Integration, interpersonale Synchronisation. Verbindet dies mit Dopaminpfaden, Amygdala-Regulation und neuroplastischen Veränderungen. (digitalcommons.lindenwood.edu) | Noch theoretisch / konzeptionell; empirische Validierung in Suchtpopulationen steht aus; oft fehlen Kontrollgruppen oder Längsschnittdaten |
| Art Therapy in der Suchtprävention / Rückfallprävention (Literaturübersichten) | Kunsttherapie wird oft als unterstützendes Element bei Rückfallprävention genannt, insbesondere bezüglich Emotionsregulation, Selbstausdruck, Bewältigungsstrategien. (digitalcommons.lesley.edu) | In vielen Fällen fehlt systematische Messung (z. B. mittels neurobiologischer Marker); methodische Heterogenität erschwert Vergleiche |
| Weitere Arbeiten aus Neuroästhetik & Kunst in der Therapie | Studien zeigen, dass ästhetische Erlebnisse Stresshormone wie Cortisol senken, Stimmung verbessern und das Belohnungssystem ansprechen können. (medlink.com) | Diese Studien sind oft nicht spezifisch auf Suchtpatienten ausgerichtet, sondern allgemeiner psychologischer Kontext |
Beispielhafte Anwendung: In der Praxis gibt es Ansätze wie „Brain Painting“ (eine künstlerische Methode, die metaphorisch „das Gehirn malen“ nutzt), die insbesondere in Schadens-, Trauma- oder Suchtkontexten als kreativ-therapeutisches Werkzeug diskutiert werden. stairwayrecovery.com
Einschätzung & offene Herausforderungen
-
Die Verbindung zwischen Kunst- / ästhetischer Erfahrung und Suchttherapie ist vielversprechend, aber noch nicht fest etabliert.
-
Viele vorhandene Studien sind kleine Fallstudien, qualitative Berichte oder Korrelationsstudien. Kausale Wirkmechanismen sind oft Spekulationen.
-
Eine Schwierigkeit ist die Heterogenität: „Kunsttherapie“ kann sehr unterschiedlich sein (Malerei, Musik, Tanz, Collage etc.), und die Zielpopulationen unterscheiden sich stark.
-
Auch ist es schwer, neurobiologische Marker (z. B. fMRT, EEG) in klinischen Setting mit Suchtpatienten zu erheben – Aufwand, Kosten, ethische Fragestellungen etc.
-
Zudem kann man nicht sicher sagen, ob ästhetische Reize bei allen Personen die gewünschte positive Reaktion auslösen — bei manchen könnten sie überfordern oder aversiv wirken.
Hier sind einige konkrete Studien, Überblicke und Forschungsprojekte, die bereits versucht haben, Kunst-/Ausdruckstherapie mit Suchterkrankungen oder (nahe liegenden) klinischen Kontexten zu verbinden, zusammen mit Einschätzungen und offenen Fragen:
| Studie / Projekt | Population / Setting | Intervention / Methode | Gemessene Wirkungen / Befunde | Bemerkungen / Methodische Limitationen |
|---|---|---|---|---|
| Kang et al. (2023): Pilot RCT bei Alkoholgebrauchsstörung (AUD) | Personen mit Alkoholgebrauchsstörung | 10 Wochen, wöchentliche Gruppen-Sitzungen (60 Minuten) Kunsttherapie | Zunahme der NK-Zellen (Immunmarker), Veränderungen in Stressproteinen, günstige Veränderungen im MMPI-2-Profil (z. B. Abnahme von Depression, Angst, Impulsivität, Alkoholabhängigkeit) (PLOS) | Pilotcharakter, relativ kleine Stichprobe, Begleitbehandlungen nicht ausgeschaltet |
| “The First Step Series: Art therapy for early substance abuse” (Holt, 2009) | Frühe Phase der Substanzgebrauchstherapie | Festgelegtes Protokoll mit fünf kunsttherapeutischen Direktiven (First Step Series, FSS) | Hier werden positive Effekte auf Engagement, Selbstausdruck und therapeutische Öffnung berichtet (ScienceDirect) | Vor allem qualitative / interventionelle Berichte, kaum kontrollierte Studiendaten |
| Do creative arts therapies reduce substance misuse? (Megranahan et al., 2018) | Verschiedene Substanzgebrauchspopulationen | Kreative/expressive Therapien (Art, Musik etc.) | Der Review findet, dass die Evidenzlage aktuell „enttäuschend niedrig“ ist – es gibt Hinweise auf positive Effekte, aber wenig hochwertige, kontrollierte Studien. (ScienceDirect) | Heterogenität der Studien, kleine Sample, methodische Schwächen |
| Art Therapy and the Recovery Process: A Literature Review (Sharp, 2018) | Menschen in Sucht-Genesung | Verschiedene Kunsttherapie-Ansätze | Der Überblick sammelt Erfahrungen und theoretische Argumente, dass Kunsttherapie den Genesungsprozess unterstützen kann (z. B. Ausdruck, Identitätswandel, emotionale Regulation) (digitalcommons.lesley.edu) | Viele Studien sind unkontrolliert oder qualitativ; wenig mit neurobiologischen Messungen |
| “Toward a Unified Neuroaesthetic Framework for Art-Based Interventions in Substance Use Recovery” (Hutson & Hutson, 2025) | Suchttherapiekontexte allgemein | Überblick / konzeptionelles Rahmenmodell | Die Autor:innen integrieren empirische Befunde und neuroästhetische Theorien, und schlagen, dass Kunst-Interventionen über sensorische Regulation, narrative Integration und interpersonale Synchronisation wirken könnten (z. B. Beeinflussung von Belohnungspfaden, Stressnetzwerken, neuronaler Plastizität). (digitalcommons.lindenwood.edu) | Noch theoretisch; wenig Originaldaten in Suchterkranktenpopulationen |
| NCT06057961 – Clinical Trial “Effect of Art Therapy Applied to Individuals with Substance Use” | Menschen mit Substanzgebrauchsstörung (klinische Studie) | Kunsttherapie | Ziel: Wirkung von Kunsttherapie auf verschiedene Parameter bei Sucht untersuchen (ClinicalTrials) | Der Status, Ergebnisse oder Veröffentlichungen sind in der öffentlichen Datenbank bisher nicht (oder noch nicht vollständig) einsehbar |
| NCT04206930 – ALEXART Study | Menschen mit Alkoholgebrauchsstörung (stationär/tagesklinisch) | Kunsttherapie bzgl. Alexithymie (Schwierigkeit, Gefühle zu identifizieren & zu benennen) | Ziel ist, zu sehen, ob Kunsttherapie die Alexithymie verbessern kann in diesen Patienten (ClinicalTrials) | Noch nicht (oder noch nicht publizierte) Datenlage |
| Art Therapy for Chronic Pain and Opioid Use Disorder | Personen mit chronischen Schmerzen und Opiatkonsum / Opioidabhängigkeit | Selbstgeleitete künstlerische Praxis als ergänzende Intervention | Die Studie beschäftigt sich mit der Akzeptanz und möglichen Effekten (Schmerzreduktion, Stimmung, soziale Verbundenheit) (withpower.com) | Der Fokus ist spezifisch auf Schmerz + Opiatkonsum; Eingeschränkte Generalisierbarkeit zu anderen Substanzstörungen |
Wichtige Erkenntnisse, Muster & Hinweise
Aus diesen Studien und Übersichtsarbeiten lassen sich einige strukturierende Einsichten ableiten:
Es gibt erste Hinweise, dass Kunsttherapie (oder kreative Interventionen) bei Suchterkrankungen physiologische Marker verändern können, z. B. Immunparameter (NK-Zellen), Stressproteine, biochemische Marker (Kang et al.) PLOS
Einige Interventionen haben v. a. psychologische Variablen gemessen wie Depression, Angst, Impulsivität, Abhängigkeitssymptome, Alexithymie oder Selbstwirksamkeit – und oft positive Veränderungen berichtet.
Viele der bisherigen Studien sind entweder Pilotstudien, qualitative Berichte oder methodisch eingeschränkt (keine bzw. schwache Kontrollgruppen, kleine Stichproben, fehlende Langzeitdaten).
Der systematische Review von Megranahan et al. (2018) kommt zu dem ernüchternden Schluss, dass der wissenschaftliche Nachweis für eine wirksame Reduktion des Substanzgebrauchs durch kreative Therapien aktuell nicht stark ist. ScienceDirect
Der Ansatz von Hutson & Hutson versucht, ein integriertes neuroästhetisches Modell anzubieten, das erklärt, wie Kunstinterventionen schuldhafte neuronale Prozesse in Sucht (Belohnung, Stress, Kontrolle) beeinflussen könnten. digitalcommons.lindenwood.edu
Manche Projekte sind in der Zukunft oder in der Rekrutierungsphase (z. B. klinische Studien), sodass die Ergebnisse noch ausstehen.
Einschätzung & offene Fragen
Diese Studien zeigen, dass in der Forschung ein wachsendes Interesse existiert, Kunst und expressive Therapien in den Kontext von Suchtbehandlung und Genesung zu integrieren. Dennoch stehen einige Herausforderungen und Lücken im Weg:
-
Mangel an hochwertigen, groß angelegten RCTs
-
Viele Arbeiten sind Fallberichte, Pilotstudien oder unkontrollierte Designs.
-
Für eine definitive Beurteilung der Wirksamkeit braucht es randomisierte, kontrollierte Langzeitstudien.
-
-
Heterogenität der Interventionen
-
„Kunsttherapie“ ist kein einheitlicher Begriff: Malerei, Zeichnung, Musik, Bewegung, digitale Medien etc.
-
Die Dosis, Dauer, Setting (Einzelsitzung / Gruppe) variieren stark, was Vergleichsanalysen erschwert.
-
-
Fehlende oder begrenzte neurobiologische Messungen
-
Nur wenige Studien messen Gehirnaktivität (z. B. via EEG, fMRT) oder andere biomarkerbezogene Parameter.
-
Es ist schwierig, direkte neuronale Veränderungen an Kunstinterventionen in Suchtpatienten nachzuweisen.
-
-
Kaum Langzeitdaten / Rückfallraten
-
Es fehlt oft eine Verfolgung über Monate oder Jahre, um zu sehen, ob Effekte stabil bleiben und Rückfälle beeinflusst werden.
-
-
Klinische/therapeutische Integration
-
Kunsttherapie wird häufig ergänzend eingesetzt, nicht als Primärtherapie.
-
Es ist unklar, wie sie idealerweise mit anderen evidenzbasierten Methoden (z. B. Motivationstherapie, kognitive Verhaltenstherapie, pharmakologische Ansätze) kombiniert werden kann.
-
-
Mechanismen und Mediatoren
-
Es bleiben Fragen: Welche genau sind die neuralen Pfade, über die Kunst auf Belohnung, Stress, Kontrolle wirkt?
-
Gibt es Subgruppen von Patienten, die stärker profitieren (z. B. mit bestimmten Arten von Traumata, spezieller Reizempfindlichkeit etc.)?
-
Laufende / geplante Studien im Bereich Kunsttherapie & Sucht / verwandte Therapien
Effect Of Art Therapy Applied to Individuals with Substance Use (NCT06057961)
Ziel: Untersuchung der Wirkung von Kunsttherapie bei Menschen mit Substanzgebrauchsstörung. ClinicalTrials
Status / Details: Die Studie ist registriert, aber öffentlich noch nicht viele Ergebnisse veröffentlicht. ClinicalTrials
Impact of Art Therapy on Alexithymia in People with Alcohol Use Disorder (ALEXART) (NCT04206930)
Ziel: Zu prüfen, ob Kunsttherapie die Fähigkeit zur Emotionsbenennung (Alexithymie) bei Menschen mit Alkoholgebrauchsstörung verbessert. ClinicalTrials
Setting: In einer tagesklinischen Suchteinrichtung (Addictology Day Hospital) ClinicalTrials
Mindfulness-Based Art Therapy and Generation Z (NCT04834765)
Kontext: Diese Studie verbindet Achtsamkeit mit Kunsttherapie und untersucht u. a. Aspekte wie Suizidgedanken, Substanzgebrauch u. a. ClinicalTrials
Hinweis: Der Schwerpunkt liegt nicht ausschließlich auf Sucht, aber Substanzgebrauch ist ein Messparameter.
Bedeutung & Aussichten dieser Studien
-
Diese Projekte sind wichtig, weil sie das Feld systematisch weiterführen – insbesondere durch definierte Messgrößen (z. B. Alexithymie, Substanzgebrauch) und (hoffentlich) kontrollierte Designs.
-
Besonders relevant ist, dass zumindest in einem Fall (ALEXART) eine klare Verknüpfung zur Emotionsverarbeitung untersucht wird – ein Wirkmechanismus, der oft als zentral in der Kunsttherapie bei Sucht diskutiert wird.
Hinweise aus Deutschland & der EU
In der Caritas-Fachambulanz für Suchterkrankungen in Grafing (bei München) ist Kunsttherapie bereits Teil des freiwilligen ergänzenden Behandlungsangebots. Dort sieht man sie als Mittel, dass sich Suchterkrankte „mit sich selbst auseinandersetzen“ können. Süddeutsche.de
In einem Forschungsartikel „Potenziale von Bildender Kunst und Kunsttherapie“ wird berichtet, dass kunsttherapeutische Studien oft eine „extreme Heterogenität“ aufweisen, was Studie, Zielgruppen und Methoden betrifft — was nahelegt, dass sehr viele kleine Versuche existieren, aber kaum systematische Großstudien. ResearchGate
Es existiert in Deutschland ein Forschungsprojekt mit Abschlussbericht zur „Entwicklung integrativer Behandlungskonzepte von Kunsttherapie und psychosomatischer Medizin“ an der FH Ottersberg. Allerdings liegt der Fokus eher auf psychosomatischen Krankheitsbildern im Allgemeinen, nicht spezifisch auf Suchterkrankungen. Peter Sinapius
Im Europäischen klinischen Prüfregister (EU Clinical Trials Register) gibt es etliche Studien, aber keine klar identifizierte, die Kunsttherapie bei Substanzgebrauchsstörungen in Deutschland oder der EU als Hauptintervention ausweist (zumindest nicht unter den Stichwörtern, die sich leicht finden ließen). (z. B. Suche in Registriernummer 2018-003335-29, siehe Registereintrag) clinicaltrialsregister.eu
Einschätzung & Empfehlungen
-
Dass Kunsttherapie in praktischen Einrichtungen schon eingesetzt wird (Grafing) ist ein positives Zeichen: Es gibt Interesse und Praxis, auch wenn wissenschaftliche Begleitforschung noch schwach ist.
-
Die öffentliche Sichtbarkeit ist aber bislang gering — Studien mit klaren Designs, großer Stichprobe, Langzeitverfolgung und neurobiologischen Messungen fehlen.
-
Es könnte sein, dass in kleineren Einrichtungen oder als Teilprojekte Kunsttherapie mit SuchtpatientInnen eingesetzt wird, aber nicht als „Studie“ registriert oder publiziert wird.