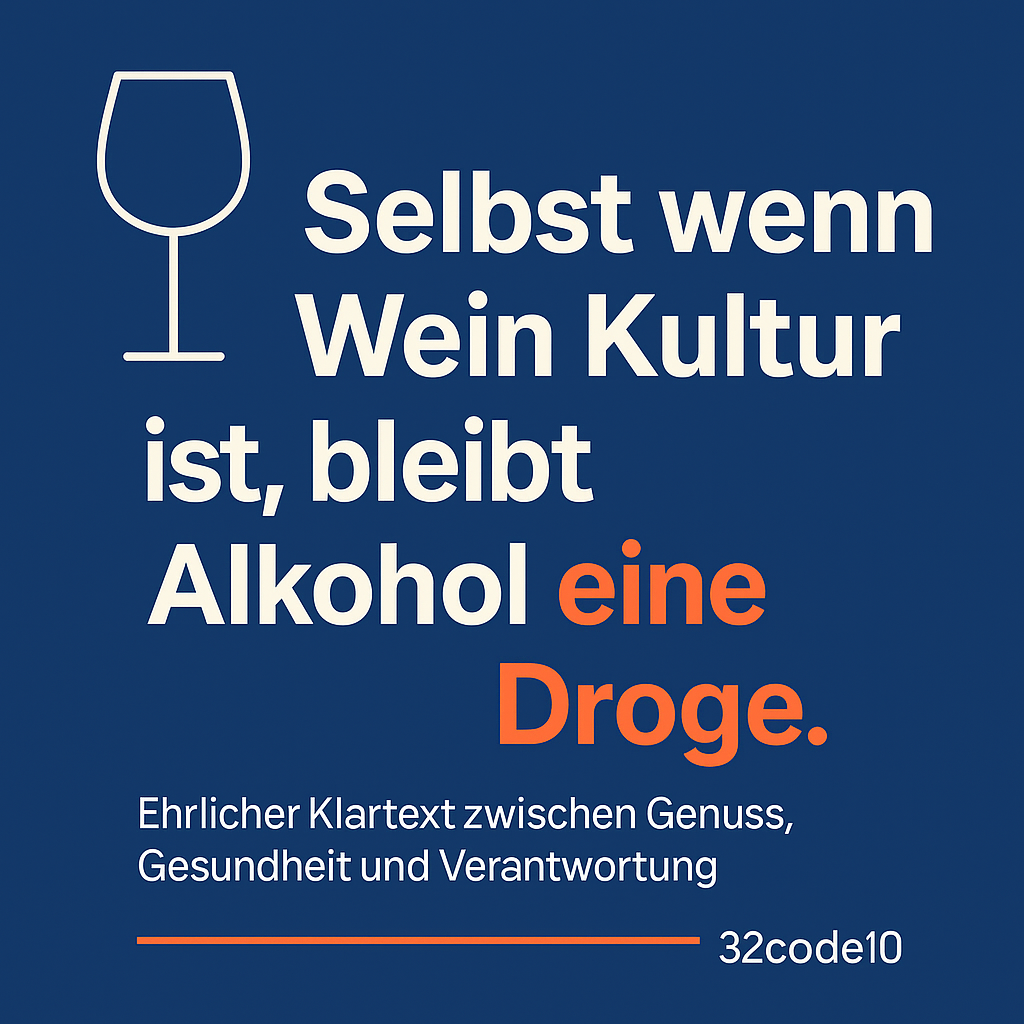Wer die Gefahr von Alkohol verharmlost, macht sich mitschuldig.
„Wer Wein zur Gefahr erklärt, verliert Maß und Respekt vor Menschen“ – Im Wirtschaftsteil der WELT verteidigt die rheinland-pfälzische Weinbauministerin den Wein als Kulturgut – und stellt dabei sinngemäß in den Raum: Maßvoller Weingenuss sei „kein gesundheitliches Risiko“ und wer Wein kritisiert, verliere den Respekt vor den Menschen dahinter.
Als abstinent lebender Erfahrungsexperte, und jemand, der sich täglich mit Sucht und Stigma beschäftigt, sehe ich das anders – und zwar nicht aus Moral, sondern aus Evidenz!
1. Einordnung: Wer spricht da – und mit welchem Interesse?
Autorin ist Daniela Schmitt (FDP), Wirtschafts- und Weinbauministerin von Rheinland-Pfalz. Sie trägt politische Verantwortung für eine Branche, von der zehntausende Arbeitsplätze in ihrem Bundesland abhängen. Der Text erscheint im Wirtschaftsteil, ist aber als „Meinung“ gekennzeichnet.DIE WELT
Das ist wichtig, weil:
Sie argumentiert gleichzeitig als zuständige Ministerin und als politische Lobbyistin für den Weinbau.
Sie verweist auf Programme wie „Wine in Moderation“, ohne offenzulegen, dass es sich hierbei um ein von der Weinindustrie getragenes CSR-Programm handelt, das international genau dafür kritisiert wird, die gesundheitlichen Risiken von Alkohol zu verharmlosen.(Movendi International)
Mit anderen Worten: Der Text ist kein neutraler Überblick, sondern Interessensvertretung.
2. Zentrale Thesen des Artikels – und was die Wissenschaft dazu sagt
2.1 „Wein ist Kultur, Handwerk, Identität – wer ihn verdammt, verliert Respekt vor Menschen“
Behauptung im Text (verkürzt):
- Wein sei seit 2000 Jahren Teil unserer Kultur, präge Landschaften und Regionen.
- Wer Wein „verdammte“, beleidige Winzer:innen und greife ein kulturerbe-ähnliches Gut an.
- Kritische Stimmen würden Menschen, die vom Wein leben, entmenschlichen.
Kurze Analyse:
- Kulturelle Bedeutung: Dass Wein in vielen Regionen eine hohe kulturelle, historische und wirtschaftliche Bedeutung hat, ist unstrittig. Das steht im Einklang mit der Realität in Rheinland-Pfalz, an Mosel, Ahr, Pfalz etc. DIE WELT
- Aber: Die Autorin setzt Kultur mit gesundheitlicher Unbedenklichkeit gleich. Aus „Wein ist Teil unserer Identität“ wird stillschweigend: „Wein ist kein Problem, sondern im Kern etwas Positives“. Der Schritt ist emotional nachvollziehbar, wissenschaftlich aber irrelevant: Auch Tabak hat eine kulturelle Geschichte – trotzdem ist er krebserregend.
- Die Formulierung, wer Wein kritisch sieht, „verliere Respekt vor Menschen“, ist ein rhetorischer Trick:
- Kritik an Produkten, Strukturen und Lobbyarbeit wird auf Einzelmenschen (Winzer:innen, Gastgeber:innen) umgebogen.
- Damit wird jede striktere Public-Health-Position moralisch delegitimiert („respektlos“, „zynisch“), statt sachlich diskutiert.
Kurz: Kultur ≠ Harmlosigkeit. Kultur kann (und muss) man benennen – aber sie widerlegt keine medizinischen und suchtbezogenen Fakten.
2.2 „Maßvoller Weingenuss ist kein gesundheitliches Risiko“
Das ist eine der problematischsten Aussagen im ganzen Text.
Behauptung im Artikel:
- Wein sei kein Getränk für „achtlosen Konsum“.
- „Maßvoller Weingenuss“ sei „kein gesundheitliches Risiko“, sondern Ausdruck einer achtsamen Lebenshaltung.
- Die WHO übertreibe mit der Aussage „kein sicherer Konsum“; wissenschaftlich sei das Bild „differenzierter“.
Was sagt die aktuelle Evidenz?
WHO, RKI, DKFZ & Co.: Kein „risikofreier“ Konsum
- Die WHO Europa stellt seit Januar 2023 ausdrücklich klar:
👉 Es gibt nach aktuellem Wissen keine Schwelle, unterhalb derer Alkohol sicher ist.
Das bezieht sich insbesondere auf das Krebsrisiko, das bereits ab geringen Mengen messbar erhöht ist. - Das Deutsche Krebsforschungszentrum fasst es ähnlich:
👉 „Es gibt keinen sicheren Alkoholkonsum. Jeder Konsum erhöht das Krebsrisiko; je mehr und je regelmäßiger, desto höher das Risiko.“ - Das RKI formuliert im Journal of Health Monitoring 2025:
👉 Nach aktuellem Stand der Forschung gibt es keinen sicheren Alkoholkonsum, Erwachsene sollten „kein oder so wenig wie möglich“ trinken.
- Die WHO Europa stellt seit Januar 2023 ausdrücklich klar:
Das steht in direktem Widerspruch zu Schmitts Satz, maßvoller Weingenuss sei „kein gesundheitliches Risiko“.
„No safe level“ bedeutet nicht: jeder Schluck = gleicher Schaden
Die WHO sagt nicht, dass ein Schluck Wein genauso gefährlich wäre wie tägliches Rauschtrinken. Sie sagt:
Das Risiko ist dosisabhängig.
Aber es gibt keinen Bereich mit Risiko = 0.
Schon < 1 Standarddrink/Tag kann z.B. bei Brustkrebs das Risiko messbar erhöhen.
Schmitt karikiert diese Position ein Stück weit, indem sie daraus eine „apodiktische“, ideologische Warnung macht.
Kardiovaskuläre Effekte & mediterrane Ernährung
Es gibt tatsächlich Studien, die bei bestimmten Personengruppen einen Zusammenhang zwischen leichtem bis moderatem Weinkonsum (ca. ½–1 Glas pro Tag) und einem niedrigeren kardiovaskulären Risiko finden, vor allem im Kontext einer mediterranen Ernährung.
ABER:
Viele ältere Studien hatten starke Bias-Probleme (z.B. „Sick Quitter“-Effekt: Ex-Trinker:innen werden mit lebenslangen Abstinenten vermischt). Darauf weist u.a. eine vielzitierte Lancet-Analyse hin.
Neuere Auswertungen und Leitlinien sagen im Kern:
👉 Wenn man nicht trinkt, sollte man nicht aus Gesundheitsgründen anfangen.
👉 Mögliche kardiovaskuläre Vorteile können das erhöhte Krebsrisiko nicht „wegzaubern“.
Die wissenschaftlich angemessene Formulierung wäre daher eher:
Kleine Mengen können bei manchen Menschen in bestimmten Kontexten kardiovaskuläre Risiken senken, aber jede Menge Alkohol erhöht z.B. das Krebsrisiko. Ein „gesundheitsfördernder“ oder risikofreier Bereich ist nach heutigem Stand nicht belegbar.
Schmitt geht einen großen Schritt weiter und behauptet pauschal „kein gesundheitliches Risiko“. Das ist so nicht haltbar.
3. Suchtperspektive: Wein vs. andere Alkoholika
Der Artikel romantisiert Wein als etwas grundsätzlich anderes als „normale“ alkoholische Getränke:
- Wein wird als Getränk für bewussten Genuss, Kultur, Gespräch inszeniert.
- Exzess, Kontrollverlust und Abhängigkeit werden implizit in Richtung „andere“ Konsumformen verschoben (Trinken „zum Vergessen“).
Faktisch:
Für das Suchtrisiko ist entscheidend: Menge, Häufigkeit, Konsummuster, individuelle Vulnerabilität – nicht, ob der Ethanol im Wein, Bier oder Schnaps steckt.
Aus suchtspezifischer Sicht gibt es keinen Bonus für Wein:
- Ein Standardglas Wein enthält etwa gleich viel Ethanol wie ein Bier oder ein Schnaps (je nach Definition).
- Je normaler und positiv konnotiert der tägliche Wein ist, desto höher die Gefahr, dass Problemkonsum lange nicht erkannt wird.
Hinzu kommt ein wichtiger Punkt:
- Die Alkoholindustrie (inkl. Wein) erzielt einen erheblichen Teil ihrer Umsätze mit Risikoträger:innen und Abhängigen, nicht mit symbolischem Genusskonsum. Studien aus UK zeigen z.B., dass ein Großteil des Umsatzes von Vieltrinker:innen stammt.
Diese Realität kommt im Artikel gar nicht vor. Sucht wird auf die psychologische Ebene („trinken, um zu vergessen“) reduziert, ohne die strukturellen, neurobiologischen und gesellschaftlichen Faktoren mitzudenken.
4. „Ideologische Kampagnen“, „Bevormundung“ vs. Aufklärung und Regulierung
Schmitt warnt davor, dass aus Gesundheitsdebatten „ideologische Kampagnen“ würden und fordert:
- weniger „Bevormundung“,
- mehr Vertrauen in die Eigenverantwortung Erwachsener,
- Aufklärung statt staatlicher Eingriffe.
Public-Health-Perspektive:
Internationale Evidenz ist ziemlich eindeutig: Reine Aufklärung (Info-Kampagnen, Appelle an Eigenverantwortung) hat sehr begrenzte Wirkung auf den Gesamt-Alkoholkonsum.
Wirksam sind vor allem:
- Preispolitik (Mindestpreise, Steuern),
- Werbe- und Sponsoringbeschränkungen,
- Verfügbarkeitsregeln (Verkaufszeiten, Alterskontrollen),
- klare Warnhinweise, insbesondere zu Krebs. (Der US-Surgeon-General z.B. fordert inzwischen explizit Krebswarnungen auf Alkohol!)
Diese Maßnahmen als „Respektlosigkeit“ oder „Moralächtung von Genuss“ zu framen, ist ein typischer rhetorischer Move der Alkohol- und Weinlobby: Man verschiebt die Debatte von Gesundheit & strukturellen Rahmenbedingungen auf individuelle Moral & Freiheit.
5. Ökologie: „Verantwortung für Natur“ vs. reale Umweltfolgen
Im Artikel heißt es sinngemäß, Winzer:innen übernähmen Verantwortung „für Natur, Qualität und Arbeitsplätze“ und Weinbau forme die Landschaft positiv.
Die Realität ist komplexer:
6. Umweltbelastungen durch Weinbau
Aktuelle Studien zeigen:
Weinberge gehören in Europa zu den am stärksten pestizidabhängigen Kulturen, insbesondere durch Fungizide (Mehltau etc.).
Das hat Folgen:
- Toxizität für aquatische Ökosysteme und für Nicht-Ziel-Organismen,
- Belastung von Böden und Grundwasser,
- Biodiversitätsverlust in intensiv bewirtschafteten Weinlandschaften.
Eine aktuelle Analyse fand zudem einen deutlichen Anstieg von TFA („Forever Chemical“) in europäischen Weinen der letzten Jahrzehnte – v.a. in Weinen mit hoher Pestizidbelastung.
7. Klima, Erosion, Landschaft
Klimawandel (Hitze, Starkregen) trifft Weinbau besonders – aber konventioneller Weinbau verstärkt oft Probleme wie Bodenerosion (monotone Reihenkulturen, Bodenbearbeitung).
Es gibt durchaus positive Ansätze:
- Biologischer/ökologischer Weinbau,
- agroökologische Maßnahmen (Begrünung, Trockenmauern, Mischstrukturen),
- Projekte, die Produktion und Biodiversität kaum in Konflikt bringen.
Environment
Aber: Die pauschale Behauptung, Weinbau stehe für „Verantwortung für Natur“, ist mindestens einseitig. Es ist vielmehr ein Feld mit massiven Umweltproblemen, in dem gerade heftig um nachhaltigere Modelle gerungen wird.
8. Wo der Artikel recht hat – und wo nicht
Punkte, die nachvollziehbar sind
Kritik an zynischen Formulierungen wie „Sterben der Weingüter ist eine gute Nachricht“:
– Ja, solche Sätze blenden komplett aus, dass dahinter reale Menschen, Existenzen, Biografien stehen. Die Kritik daran ist berechtigt – der Satz ist tatsächlich menschenverachtend formuliert.
Hinweis auf Kultur & Identität:
Weinbau ist in vielen Regionen ein wichtiger Teil von Geschichte, Gemeinschaft und regionalem Selbstverständnis. Das zu sehen, ist wichtig, gerade wenn Strukturwandel ansteht.
9. Punkte, die deutlich im Widerspruch zur Evidenz stehen
„Maßvoller Weingenuss ist kein gesundheitliches Risiko“
- steht direkt gegen WHO, DKFZ, RKI und internationale Leitlinien, die klar sagen:
👉 Es gibt keine nachweisbar sichere Schwelle; jede Menge erhöht bestimmte Risiken, insbesondere für Krebs.
Suggestion, die WHO-Position sei „apodiktisch“ und wissenschaftlich nicht differenziert ist unfair: die WHO-Texte selbst betonen die Dosis-Wirkungs-Beziehung, sie richten sich an Bevölkerungen, nicht an Individuen, und sie differenzieren deutlich nach Krankheiten.
Ausblendung der Suchtproblematik:
- Kein Wort dazu, dass gerade in einem Land mit hoher Pro-Kopf-Trinkmenge und vielen Abhängigkeitsverläufen Wein zentraler Teil des Problems ist.
- Kein Wort dazu, dass eine große Umsatzspanne auf Risikokonsum basiert, nicht auf symbolischen Wasserglas-Mengen.
Ökologie:
Der Artikel behauptet faktisch „Weinbau = verantwortungsvoll + Naturpflege“, ohne auf die gut dokumentierten Pestizid-, Boden- und Wasserprobleme einzugehen.
Rahmung von Regulierung als Respektlosigkeit:
Dass Warnhinweise, Werbebeschränkungen oder höhere Steuern ein Zeichen von „Misstrauen“ oder „Respektverlust“ seien, ist eine politische Deutung, keine fachliche. Aus Public-Health-Sicht sind das schlicht Instrumente, die nachweislich funktionieren.
10. Kurzes Gesamtfazit
Wenn man das Ganze auf eine Formel bringt, dann ungefähr so:
Der Artikel verteidigt Wein als Kulturgut, aber er verharmlost die wissenschaftlich gut belegten Gesundheits- und Umweltrisiken von Alkohol und Weinbau.
- Ja: Wein ist für viele Teil von Kultur, Biografien und regionaler Identität.
- Ja: Die Art, wie manche Kritiker:innen formulieren, kann verletzend und zynisch sein.
Aber:
- Alkohol bleibt ein krebserregender, suchterzeugender Stoff – auch im Weinglas.
- „Maßvoll“ heißt „relativ geringes Risiko“, nicht „kein Risiko“.
- Der Weinsektor hat handfeste ökologische Hausaufgaben.
Und es ist nicht respektlos, diese Realität zu benennen – respektlos wäre eher, sie aus Rücksicht auf wirtschaftliche Interessen zu verschweigen.